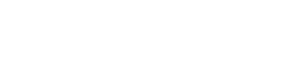Anmerkungen zu dem Text von Heidi Simoni „Sozialwissenschaftliche Grundlagen“ (2012) sowie dem Text der Nationalen Ethikkommission zur Samenspende (2019)
7. September2021
I. Text: Sozialwissenschaftliche Grundlagen zu den Konzepten „Kindeswohl, Familie und Elternschaft“ im Fortpflanzungsmedizingesetz, Heidi Simoni, 2012
1)Familienstabilität und Instabilität
Heidi Simoni stellt fest: Familien-Instabilität ist ein wesentlicher Risikofaktor für das Kindeswohl. Kinder wachsen in stabilen Familien besser auf als in instabilen Familien.
Schon 2012 konnte man wissen, dass lesbische Partnerschaften möglicherweise instabiler sind als verschiedengeschlechtliche Partnerschaften.[1] Heute wissen wir aber sehr viel mehr:
Studien zeigen, dass gleichgeschlechtliche, insbesondere lesbische, Partnerschaften erheblich instabiler sind als heterosexuelle Partnerschaften.[2] Zudem: Wenn Kinder in einer heterosexuellen Partnerschaft mitleben, erhöht sich die Stabilität der Partnerschaft. Wenn Kinder in einer lesbischen Partnerschaft mitleben, wird die lesbische Partnerschaft dadurch noch instabiler. In einer heterosexuellen Partnerschaft führen mitlebende Kinder also zu größerer Stabilität der Familie; in einer lesbischen Partnerschaft führen mitlebende Kinder zu einer noch größeren Instabilität der Familie.[3]
2) Lohnt sich um des Kindeswohls willen eine sozialpolitische Förderung des Zivilstands Ehe?
Heidi Simoni verneint diese Frage. Die sozialpolitische Förderung der Ehe als Institution, so Simoni, bringe nichts Wesentliches für das Kindeswohl. Es lohne sich nicht, so Simoni „zum Wohl der Kinder staatlicherseits auf den Schutz und die Förderung der Ehe zu setzen“ (S. 51). Der Effekt dieses Zivilstands auf das Kindeswohl sei „ausgesprochen klein“ (S. 51).
Weder die Ehe an sich [weil das auch Mutter und Stiefvater meinen kann], noch die biologische Elternschaft an sich (weil das auch Patchworkfamilie und nicht verheiratete Eltern meinen kann) seien ausreichend für das Kindeswohl. Simoni zitiert den graphisch in ihrem Text hervorgehobenen Satz: „Die Forschung hat gezeigt, dass weder die Ehe an sich noch zwei biologische Eltern an sich ausreichende Bedingungen sind. In verheirateten Stieffamilien, in komplexen zwei-biologische-Eltern-Familien [Patchworkfamilien] und in Familien mit zwei biologischen kohabitierenden Eltern geht es den Kindern schlechter als in einfachen zwei-biologische-Eltern-miteinander-verheiratet-Familien.“[4]
Die aktuelle Forschung zeigt: Beides zählt. Es ist aber tatsächlich nicht die Ehe an sich. Es ist vor allem das unverletzte biologische Band des Kindes zu beiden Eltern, Mutter und Vater, das von herausragender Bedeutung für das Kindeswohl ist. Wenn das Kind mit seinen beiden biologischen Eltern aufwächst, die in einer Ehe miteinander verheiratet sind, wenn also beides erfüllt ist – Ehe der Eltern und biologisches Band zu beiden Eltern – geht es dem Kind am besten.[5] In einer gleichgeschlechtlichen Familie fehlt immer das biologische Band zu einem der beiden Elternteile und letztlich damit zu 50% der Herkunft und des Ursprungs des Kindes.
3) Geschlecht der Eltern
Zur Bedeutung des Geschlechts der Eltern für das Kindeswohl geht Simoni lediglich auf drei Studien ein (Golombok 2003, Golombok 2010, Rupp 2009) sowie auf eine Zusammenstellung von Studien (Biblarz&Stacey 2010).
Einerseits heißt es zwar bei Simoni: „Ein hohes väterliches Engagement hat außerdem einen direkten positiven Einfluss und reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder in der Adoleszenz psychische Probleme entwickeln.“ Zugleich sollen die Hinweise auf die genannten Studien aber belegen, dass es für das Kindeswohl den Vater (oder die Mutter) gar nicht braucht. Es genüge eine nicht definierte „Qualität des Elternseins“. Geschlecht als tief in die anthropologische Struktur des Menschen eingeschriebene Größe ist plötzlich völlig unwichtig – was macht das mit den Kindern, von denen jedes ja auch ein Geschlecht hat?
Die von Simoni erwähnten Studien (Golombok 2003, Golombok 2010, Rupp 2009) haben erhebliche methodische Mängel: Kleine Probandenzahl; willkürliche Stichproben; Probanden sind häufig alleinstehende lesbische Frauen, keine lesbischen Paare; als Kontrollgruppe dienen oft alleinstehende heterosexuelle Frauen; vorwiegend „weiche“, d.h. nicht objektiv nachweisbare Daten. Interviews mit Müttern über das Ergehen ihrer Kinder erbringen meist weiche Daten, ebenso Selbstbeurteilungen von Kindern.[6] Keine der Studien kann die Frage, ob Kinder in gleichgeschlechtlichen Familien ebenso gut aufwachsen können wie bei Mutter und Vater, valide beantworten.
Zusätzlich führt Simoni den Artikel von Biblarz&Stacey (2010) an, eine Zusammenstellung verschiedener Studien. Zum Thema Kindeswohl (child outcomes[7]) werden zwar etliche, zum Teil auch ältere Studien angegeben. Fast alle Studien beruhen auf willkürlichen Stichproben oder nutzen vorwiegend weiche, also nicht objektiv nachprüfbare Daten. Sie sind für die Frage, ob Kinder ebenso gut bei gleichgeschlechtlichen Paaren wie bei Mutter und Vater aufwachsen können, nicht aussagekräftig. Eine wichtige Ausnahme ist die Studie von Wainright und Kollegen (2004) mit Zufallsstichprobe und harten Daten. Nach Bereinigung zahlreicher Kodierungs- und anderer Fehler wie etwa dem „Verschwinden von Daten“[8] zeigen die Studien von Wainright (2004, 2006,2008[9]): Kindern mit gleichgeschlechtlichen Eltern leiden psychisch deutlich mehr als Kinder mit verschiedengeschlechtlichen Eltern.[10]
Biblarz&Stacey (2010) geben den Hinweis, dass Mädchen aus lesbischen Familien sich seltener als heterosexuell bezeichnen.[11] Auch hier wissen wir heute sehr viel mehr.
Die Psychiaterin und lesbisch lebende Aktivistin Nanette Gartrell veröffentlichte 2019 die Daten ihrer „Nationalen, prospektiven Langzeitstudie lesbischer Familien“, in der lesbische Familien mit geplanten Kindern befragt werden. Die Kinder sind zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre alt.[12] Fast 69% der Mädchen aus lesbischen Familien geben eine gewisse homosexuelle Anziehung an oder sind sich unsicher; 54% geben Erfahrungen mit homosexuellem Verhalten an; 30% geben eine lesbische oder bisexuelle Identität an. Diese Prozentzahlen sind wesentlich höher als bei Mädchen, die mit Mutter und Vater aufgewachsen sind. Bei den erwachsenen Jungen aus lesbischen Familien geben 27% geben eine gewisse homosexuelle Anziehung an oder sind sich unsicher; 33% geben Erfahrungen mit homosexuellem Verhalten an; 10% geben eine schwule oder bisexuelle Identität an. Auch diese Zahlen sind wesentlich höher als in der Allgemeinbevölkerung.
II. Text der Nationalen Ethikkommission „Samenspende“ (32/2019)
Hier heißt es: „Kinder, die von gleichgeschlechtlichen Paaren aufgezogen werden, geht es ebenso gut wie solchen, die bei verschiedengeschlechtlichen Paaren aufwachsen (Tasker 2005, Simoni 2012, S. 52f). Als Quelle für diese Behauptung wird lediglich der Artikel von Simoni angegeben (siehe oben) und die Zusammenstellung von Tasker 2005.[13]
Fiona Tasker geht 2005 davon aus, dass es in den USA 2-14 Millionen Kinder gibt, die mit lesbischen oder schwulen Eltern leben. Realistische neue Zahlen sind aber viel geringer, weniger als 10% der von Tasker angegebenen Zahlen. Man geht heute von 200.000 bis maximal 400.000 Kindern aus, die in den USA bei gleichgeschlechtlichen Elternpaaren leben.[14] Das ist nur ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, sorgfältig mit Zahlen und Daten umzugehen.
Für ihre Behauptung, dass Kinder mit alleinstehender lesbischer Mutter oder alleinstehendem homosexuellen Vater oder auch mit gleichgeschlechtlichen Elternpaaren eine ebenso gute psychosoziale Entwicklung durchmachen wie Kinder, die bei ihrer Mutter und ihrem Vater aufwachsen, gibt Fiona Tasker in ihrer Tabelle über 30 Studien an. Teilweise haben dieselben Autoren mehrere Studien verfasst. Fast alle Studien wurden vor dem Jahr 2000 veröffentlicht, viele sogar schon vor 1990 oder in den Anfänger der 1990er Jahre. Keine Studie wurde nach dem Jahr 2004 veröffentlicht. Aus heutiger Sicht müssen diese Studien als veraltet gelten. Sie haben erhebliche methodische Mängel: Willkürliche Stichproben; alleinstehende lesbische Mütter (oder schwule Väter) werden befragt; keine Kontrollgruppe oder alleinstehende heterosexuelle Mütter als Kontrollgruppe; vorwiegend „weiche“ Daten.[15] Zur Frage, ob Kinder mit gleichgeschlechtlichen Elternpaaren ebenso gut aufwachsen wie mit Mutter und Vater, kann keine dieser Studien eine valide Auskunft geben.
III. Es gibt Unterschiede
Dagegen zeigen neue, auf repräsentativen Datensätzen aufbauende Studien, dass es Unterschiede gibt zwischen Kindern, die in gleichgeschlechtlichen Familien aufwachsen, und Kindern, die mit Mutter und Vater aufwachsen.
Beispiele:
Douglas Allen, 2013[16]Studie beruht auf kanadischer Volkszählung. Kinder in gleichgeschlechtlichen Familien schneiden in den Schulabschlüssen schlechter ab.
Paul Sullins, 2015[17] Repräsentative Stichprobe, 207 007 Kindern, 512 Kinder mit gleichgeschlechtlichen Eltern. Bei den Kindern in gleichgeschlechtlichen Familien ist das Risiko für ernsthafte emotionale Probleme mehr als doppelt so hoch wie bei Kindern in gegengeschlechtlichen Familien. Wird als Vergleichsgruppe nur die Gruppe der Kinder genommen, die bei ihren leiblichen, miteinander verheirateten Eltern leben, ist das Risiko für Kinder in gleichgeschlechtlichen Familien sogar um das Dreieinhalbfache erhöht.
Daniel Potter, 2017[18] Kinder aus gleichgeschlechtlichen Familien geht es psychosozial schlechter, das liegt aber vor allem an größerer Instabilität der Familien.
Douglas Allen, 2019[19] Repräsentative Studie mit Daten aus USA und Kanada. Das Mitleben von Kindern erhöht die Instabilität lesbischer Familien (die sowieso schon instabiler sind). weiter. Instabilität ist ein bekannter Risikofaktor für das Kindeswohl.
Nanette Gartrell, 2019 Kinder aus lesbischen Familien nehmen häufiger selbst eine lesbische/schwule oder bisexuelle Identität an. Ob das ein Nachteil oder Vorteil für die Kinder ist, kann hier nicht diskutiert werden. Es ist aber ein Unterschied.
Paul Sullins (2020/2021) Daten statistisch repräsentativ für Kinder aus den USA. Es geht um psychische, psychosoziale und schulische Probleme. In allen gemessenen Bereichen schneiden Kinder, die mit ihren beiden biologischen, verheirateten Eltern, mit Vater und Mutter, aufwachsen, besser ab als Kinder mit gleichgeschlechtlichen Eltern.
In sechs der sieben Bereiche schneiden Kinder mit gleichgeschlechtlich verheirateten Eltern nochmals schlechter ab als Kinder mit gleichgeschlechtlich nicht-verheirateten Eltern. Bildung und Einkommen sind bei den gleichgeschlechtlich-verheirateten Eltern am höchsten im Vergleich zu allen anderen Familienformen. (Siehe Tabelle im Anhang)
IV.Die Biologie zählt
Eine Forschung von Sullins (2015) zeigt: Der entscheidende Faktor, der den Unterschied in der psychischen Gesundheit der Kinder im Vergleich der Familienstrukturen erklären konnte, war nicht die Ehe der Eltern, sondern das Aufwachsen mit den eigenen, leiblichen (biologischen) Eltern12. Nicht die Ehe als solche war also der entscheidende Faktor, sondern die gemeinsame, leibliche Elternschaft.13
Das Fehlen gemeinsamer biologischer Elternschaft ist aber immer eine Gegebenheit in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Keine rechtliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Beziehungen kann diesen biologischen Unterschied ausgleichen. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass größere emotionale Probleme ein bleibendes Merkmal für Kinder in gleichgeschlechtlichen Familien sind.
Anhang: Tabelle
[1] Siehe Stacey&Biblarz 2010, eine Hauptquelle für Simoni. Simoni geh aber nicht auf diesen Hinweis ein.
[2] Schumm, W., Same-Sex Parenting Research, 2018, a.a.O. Schwule Partnerschaften sind oft stabiler, also länger anhaltend als lesbische Partnerschaften, manchmal so lang anhaltend wie heterosexuelle Partnerschaften. Allerdings werden schwule Beziehungen üblicherweise als sexuell offene Beziehungen geführt..
[3] Allen, D. 2019. Repräsentative Daten aus Kanada und USA.
[4] Simoni, H., S. 51 zitiert hier Brown 2010
[5] Unter anderem Sullins 2015, Sullins 2021.
[6] Kinder schützen bei Befragungen in der Regel ihre Eltern. – Harte Daten sind etwa: Verwendung des SDQ zur Beurteilung psychischer Probleme beim Kind. Der SDQ ist ein weltweit anerkannter Test. Unabhängige Verhaltensbeobachtungen bei Kindern.
[7] Biblarz&Stacey, 2010, Tabelle S. 8.
[8] Schumm, W., 2015.
[9] Die drei Studien von Wainright und Kollegen beruhen auf denselben repräsentativen Datensätzen.
[10] Re-Evaluierung der Daten durch Sullins, P., The Unexpected Harm, 2015.
[11] Der Hinweis wurde von Simoni nicht aufgenommen.
[12] Gartrell, N., 2019.
[13] Tasker, 2005.
[14] Schumm, W. 2018, S. 73.
[15] Ob die erste studie auf einer Zufalsstichprobe beruht, ist nicht ganz klar. Alles 2013
[16] Allen, 2013
[17] Sullins, P, 2015, Emotional Problems. Stigmatisierung soziale Stigmatisierung (Ausgrenzung, Schikane, Hänseleien) war zwar ein Faktor für das Auftreten psychischer Probleme bei den Kindern. Allerdings hatten 19,2% der Kinder aus gegengeschlechtlichen Familien soziale Stigmatisierung durch Gleichaltrige erlebt verglichen mit nur 15,1% der Kinder, die bei gleichgeschlechtlichen Eltern lebten. Der Unterschied war nicht signifikant
[18] Potter, 2017.
[19] Allen, 2019.